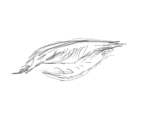Neues aus der Anstalt: Der New Game Journalism – Zocken als Reiseführer
29 August, 2016
Jedes Spiel besteht aus einer bestimmten Anzahl einzelner Komponenten – quasi seine chemische Zusammensetzung. Es hat eine Spieldauer von X Stunden, bemüht die Story Y und beruht auf der Spielmechanik Z. Wenn wir über Spiele sprechen, beziehen wir uns oft auf diese Elemente. Wenn wir Spiele bewerten, sieht das ganz ähnlich aus: Was soll der Story-Mode in Baldur´s Gate Remastered? Viel zu einfach und der komplette Gegensatz zu dem, was das Original zum legendären Spielspaß machte: Ein Schwierigkeitsgrad, der sich gewaschen hat! Das Balancing bei Dishonored? Einmal die Teleporter-Fähigkeit an und – zack! – Corvo kann Gegner am Fließband ins Reich der Träume befördern. Und die Spieldauer von Inside? Für den Preis schon ziemlich ärgerlich.
Balancing, Spieldauer, Hintergrundstory – alles nur mechanische Einzelemente eines Spiels. Sie bilden das Gerüst des Spiels. Warum es so funktioniert, wie es funktioniert. All diese Einzelemente zusammengenommen machen ein Spiel aus. Ob ein Spiel gut oder schlecht ist hängt davon ab, ob seine Mechanik gut oder schlecht ist. Macht Sinn, oder? Deshalb die Tendenz des Spielejournalismus, die Mechanik der Spiele analytisch zu durchleuchten. Um herauszufinden, ob ein Spiel gut ist oder nicht, wird seine Mechanik daraufhin analysiert, ob sie gut ist oder nicht. Wie ein Chemiker, der untersucht, aus welchen Bestandteilen eine Droge besteht. Die Immersion, das Spielen selbst – das, was der Spieler dann am Ende fühlt, wenn er vor dem Bildschirm sitzt, ist doch nur das Ergebnis all dieser Elemente gemeinsam. Die Spielelemente bestimmen, wie wir ein Spiel erleben.
Oder?
Nein, meint Kieron Gillen, Spielejournalist und Autor des „New Game Journalism Manifesto“. Der analytische Zugang zu Spielen greife zu kurz. Ein hermeneutischer, immersiver Ansatz müsse her. Kurzum: „Write travel journalism to imaginary places“! Der derzeitige Spielejournalismus, so Gillen, vermittelt etwas sehr Begrenztes: Er soll dem Leser ausreichend Informationen stellen, die ihn zu einer Entscheidung befähigen, ob er ein bestimmtes Spiel nun spielen soll oder nicht. Anders gesagt: Ob er ein bestimmtes Spiel nun kaufen soll oder eben nicht: „Games Magazines are, primarily, buying guides“. Ungefähr so, wie ich mich durch Testberichte arbeite, bevor ich den neuen Kühlschrank kaufe. Aber darum geht es ja vielleicht gar nicht. Vielleicht will ich ja einen Eindruck von einem Spiel bekommen, ohne es vielleicht gar jemals selbst spielen zu wollen, einen Eindruck von dem, wodurch es sich auszeichnet, wie die „Stimmung“ ist, welche Geschichten (auch mit oder gegen andere Spieler) ich damit und darin erleben kann. Ob es Orte bietet für Anekdoten. Für Erinnerungen. Für Geschichten. Oder in Anlehnung an den Travel Journalism: Wo man am besten looten…äh…essen gehen kann in DayZ.
Der derzeitige Spielejournalismus beschränkt sich auf die Analyse von Spielmechaniken. Eben wie genannter Chemiker, der untersucht, aus welchen Bestandteilen die Droge besteht.
Das kann aber nicht fassen, wie die Wirkung der Droge auf den ist, der sie nimmt.
Dieses Ergebnis ist ein Ergebnis des Zusammenspiels verschiedener mechanischer Komponenten, ja. Aber nicht nur. Ein Spiel ist immer ein Spiel + x. Das Spiel selbst besteht aus all den verschiedenen Komponenten, die zusammen eine bestimmte Spielerfahrung simulieren. Wie diese Spielerfahrung aber letztlich aussieht, bestimmt das + x. Und das ist stets subjektiv. Darauf spielt Gillen in seinem „Manifest“ an, wenn er meint, dass der Wert eines Spiels nicht im Spiel selbst, sondern im Spieler liegt. Durch diesen Zugang könnte sich vor allem ändern, dass Spielemedien typischerweise ein Spiel nur solange auf dem Schirm haben, solange es a, noch nicht erschienen ist (Preview) oder b, gerade neu erschienen ist (Test). Dies passt natürlich zu der erwähnten Eigenschaft, dass sie primär „Einkaufsführer“ sind. Wenn ich den Kühlschrank, nach langem Wälzen der Testberichte, endlich gekauft habe, brauche ich ja keine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema Kühlschrank.
Was nun spannend wäre, und was der New Game Journalismus will, wäre, an dem Punkt erst richtig mit dem Schreiben über ein Spiel zu beginnen, wenn es schon erschienen ist. Und das auf die Art eines Reisenden in einer fremden Welt – eben im Stil des „travel guide for imaginary places“. Ja, Storyhintergründe und Kontexte eines Spiels werden auch im Spiele-Test behandelt. Aber lediglich als kurzer Faktenabriss, der sich oft liest wie dieser schreckliche eingerahmte Kasten aus dem Geschichtsbuch 8. Klasse Gymnasium: Langweilig. Und das auch zu Recht, da die wenigsten Spiele die narrative Reichweite eines Bioware-Epos haben. Aber das ist auch nicht wirklich wichtig. Die Story des Spiels selbst ist selten das, was ein Spielerlebnis für den Spieler besonders macht (oder eben nicht). Es ist die Story des Spielers, die ausschlaggebend für den Spielspaß ist. Das, was er erlebt hat in dieser anderen Welt, welche Geschichten er zu erzählen hat. Gillen meint, es reiche nicht aus schlicht zu schreiben, was in dieser Welt vor sich geht. Man muss dem Leser begreiflich werden lassen, wie es sich anfühlt, in dieser Welt zu sein. Es ist wie mit einem guten Reisebericht: Man liest und ist unterhalten und lernt sogar etwas über diese andere Welt, ohne dass man selbst in diese andere Welt aufbrechen müsste und auch wenn man überhaupt nicht vorhat, selbst einmal dort hinzureisen.
Der New Game Journalism kennt keine Wertungstabellen mit Prozenturteilen, Infokästen oder Vergleichswerten. Er beschreibt, wie es sich anfühlt, dort zu sein. Der Blogger Ian „Always Black“ Shanahan hat es in seinem Artikel „Bow, Nigger“ vorgemacht. 2004 in einem Multiplayer-Erlebnis während eines Zweikampfes in Jedi Knight II entstanden, erzählt „Bow, Nigger“ mit Anleihen an Hunter S. Thompson und Truman Capote die ganz persönliche Geschichte des Spielers im Spiel. Zugleich wird das subjektive Erlebnis aber im Rahmen der Welt von Jedi Knight II verhandelt: Duelliertricks und -tipps werden im direkten Zweikampf besprochen. Kodices der Jedi-Ritter, die zwischen den Spielern große Bedeutung haben wie etwa die Verbeugung vor dem Kampf, werden wirksam, weil sie der Gegner des Spielers im Duell wohlweislich missachtet. Der Spieler verbeugt sich trotzdem. Nicht, um seiner virtuellen Rolle als Jedi-Ritter zu entsprechen. Sondern aus dem Trotz heraus, das (spielintern) Richtige zu tun, selbst wenn der Gegner das Duell mit der Aufforderung „Bow, Nigger“ beginnt. Der Artikel, der nun folgt, ist so dynamisch wie das Duell selbst. Und als der Spieler am Ende, mit einem einzigen verbleibenden Health Point, tatsächlich siegt, ist es nicht nur ein Sieg über einen unbekannten Gegenspieler in Jedi Knight II, sondern ein Sieg über Rassismus und über die Hybris des Menschen. So zumindest fühlt es sich an. Der Artikel endet mit: „I´m a fucking hero. A real one“.
Das Spiel selbst kann das nicht erklären: Spieler kämpfen mit Laserschwertern mit oder gegen Spieler in einem Multiplayer-Forum im Franchise des Star Wars-Universums. Das ist im Großen und Ganzen die Spielmechanik. Widerstand gegen Rassismus, Respekt vor dem jeweils Anderen, Abkehr von menschlicher Hybris – das alles sind Narrationen, die das Spiel nicht enthält. Der Spieler selbst erst erschafft diese, indem er spielt. Indem er spielt, schreibt er Geschichte in fremden Welten. Es sind diese Geschichten, die der New Games Journalismus erzählen will.
So könnte ein neuer Zugang zu Games eröffnet werden. Einer, der eine viel größere Zielgruppe erreichen kann als bislang der Fall. Eben weil sich dieses Schreiben über Games nicht auf die Mechanik beschränkt. Die kann letztlich nicht erklären, warum Menschen weltweit Stunden um Stunden vor Bildschirmen verbringen und sich ihre Zeigefinger/Daumen/oder sonstige Zockerextremitäten wundspielen, ohne darüber nachzudenken, dass es nun soundsoviele Levels gibt und wieviele Waffen eigentlich und hey, das Balancing, ist das denn ausgeglichen? Dieses neue Schreiben über Games wendet sich zurück auf die grundlegende Frage: Warum denn überhaupt Gaming? Und gibt dann so viele Antworten, wie es Menschen vor Bildschirmen gibt.